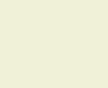
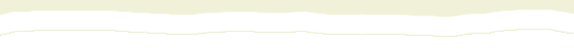
 |
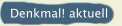 |
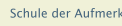 |
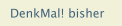 |
 |
 |
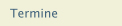 |
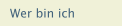 |
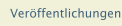 |
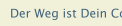 |
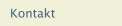 |
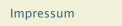 |

Café DenkMal Philosophisches Café am 02.
Januar 2026
Thema: Funktion und Wirkung des Opfers
Opfern: Das
Wort stammt wohl vom Mittelhochdeutschen und könnte mit Almosen geben verbunden
werden. Die Herkunft vom lateinischen offerre bedeutet darbringen. (s.
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache)
René Girard
Die Entwicklung des
religiösen Denkens in den früheren archaischen Gesellschaften unserer Vorfahren
geht mit der Ausbildung von Normen einher, die das Ausbreiten der Gewalt
innerhalb der Gruppe verhindern oder steuern. Für archaische Gesellschaften ist
das Bewusstsein, dass Mimesis und Gewalt dasselbe Phänomen sind, von zentraler
Bedeutung. Gewalt wird verhindert, indem man die mimetische
Verdoppelung/Spiegelung zwischen Individuen derselben Gruppe verbietet. Girard
postuliert die Existenz einer fundierenden Erfahrung, die ein für alle Mal
gezeigt hat, dass die Gewaltspirale durch die Opferung eines Sündenbocks unterbrochen
wird. Hat die mimetische Gewalt in einer Gruppe einen Punkt erreicht, in dem
alle die Gewalt aller nachahmen und das Objekt, das die Rivalität ausgelöst
hat, „vergessen“ ist, so stellt das Auftreten eines einmütig als schuldig
empfundenen Individuums eine einheitsstiftende Polarisierung der Gewalt dar:
Die Tötung oder Ausstoßung des „Schuldigen“ reinigt die Gruppe von der
Gewaltseuche, weil diese letzte – gemeinsam vollbrachte – Gewaltanwendung
keinen mimetischen Vorgang (Rache) mit sich bringt. Da auch das Objekt, das die
Krise ausgelöst hat, vergessen ist, ist die Reinigung durch diese Opferung
vollständig. (nach wikipedia)
Marcel Mauss
Im Mittelpunkt seiner
Erforschung der Gabe steht die Frage, warum man Gaben erwidern muss. Die
Antwort liegt darin begründet, dass sich in der Gabe Person und Sachen mischen,
man beim Geben einen Teil von sich gibt und im Nehmen der Gabe insofern eine
Fremderfahrung des Anderen macht. Mauss untersucht diese Vermischung von Person
und Sache nicht nur in fremden Kulturen, sondern auch in unterschiedlichen
europäischen Rechtssystemen (bei den Römern oder Germanen), um schließlich von
den fremden und alten Kulturen auf die gegenwärtigen Gesellschaften
überzuleiten und dort die moralischen Folgerungen aus den Praktiken der Gabe
auszuloten.
Der Essai sur le don war
die erste grundlegende vergleichende ethnographische Arbeit über die Gabe. Als
systematische und vergleichende Studie analysiert sie das System des
Geschenkaustauschs und deutet seine Funktion im Bezugsrahmen der
gesellschaftlichen Ordnung. Mauss stellt das moralische,
psycho-ökonomische Prinzip der Gabe in seinem Zwangscharakter und seiner
Schuldverursachung heraus und bringt die Gabe mit dem zweideutigen
englischen gift zusammen. Damit kann er die Prinzipien von
Arbeit, Dienstleistung, Sozialstaat und Wohlfahrt analysieren. Mauss
prägte hierfür den Begriff der „Schenkökonomie“. (nach wikipedia)
Wer sich selber hasst, den haben wir zu fürchten, denn wir werden
die Opfer seines Grolls und seiner Rache sein. Sehen wir also zu, wie wir ihn
zur Liebe zu sich selbst verführen! (Friedrich Nietzsche)
Man ist Man seines Fachs um den Preis, auch das Opfer seines Fachs
zu sein. (Friedrich Nietzsche)
Der Staat zeigt sich nur selten dazu fähig, den Einzelnen für das
Opfer zu entschädigen, das er von ihm gefordert hat. (Sigmund Freud)
Die Demut ist der Altar, auf dem Gott will, dass man ihm Opfer
bringe. (Francois de la Rochefoucauld)
Viel Gutes kann der Mensch vollbringen, ohne sich ein Opfer
zumuten zu müssen. (Albert Schweitzer)
Große Opfer sind Kleinigkeiten, die kleinen sind es, die schwer
sind. (Heinrich von Kleist)
Vergiss nicht, dass es besser ist, Opfer zu sein als Henker.
(Anton P. Tschechow) Das
Opfer kostet jene nichts, die keine Leidenschaften kennen.
(Romain Rolland)
Durch das Opfer bestätigt die Revolution den Aberglauben. (Charles
Baudelaire)